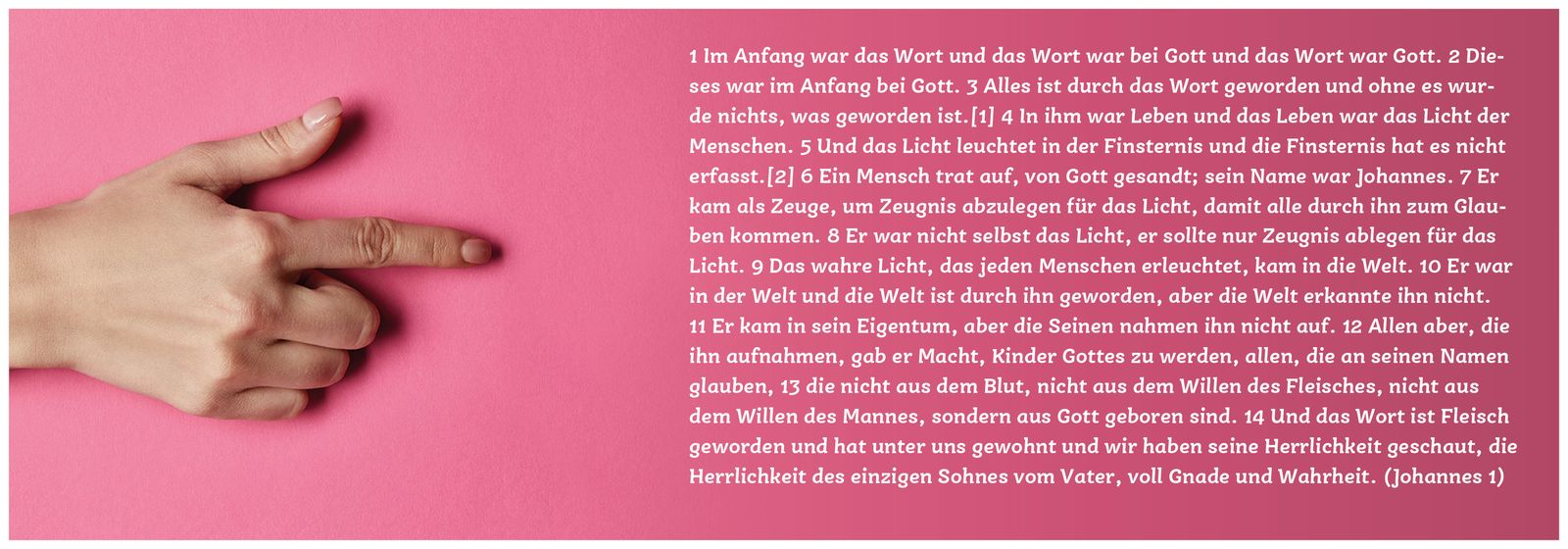
HB: Was ist für Sie persönlich das Besondere und Faszinierende am Johannes-Evangelium?
US: Hier ist nichts zufällig! Die Begegnungen mit Menschen. Die Zeichen, jedes einmalig. Jesus will uns nicht kleinhalten, sondern aufrichten auf Augenhöhe. Der Gottessohn will keinen Wunderglauben, sondern uns die Augen öffnen: Gott ist in der Welt. „Kommt und seht!“ (Joh 1,39). Mit dem Entdecken bin ich nie fertig. Und: Gott meint mich! Gerade wenn ich glaube, nicht dazuzugehören (die Samariterin in Joh 4). Er ruft einzelne beim Namen („Maria“ in Joh 20), damit wir uns trauen, unseren Namen in die seltsamen „Leerstellen“ einzutragen (z.B. der namenlose Jünger in Joh 1,35f).
BS: In meinen Weiheexerzitien vor 25 Jahren war der geistliche Impuls: „Leben hat Sinn. Christliche Existenz nach dem Johannesevangelium.“ Beim Lesen meiner damaligen Notizen wird mir wieder lebendig, wie Worte aus dieser Frohen Botschaft bei mir Gesicht bekommen haben. Die Spiritualität des 4. Evangeliums ist „Begegnung“. Die Begegnungsgeschichten, z.B. die Samariterin am Jakobsbrunnen, oder von Maria Magdalena, oder vom ungläubigen Thomas etc. vertiefen die Suche nach sinnvollem Leben. In diesen biblischen Begegnungen werde ich selbst als Leser hineingenommen: ich bin mittendrin.
HB: Wie würden Sie die zentralen theologischen Grundaussagen dieses Evangeliums und ihre Bedeutung für uns heute beschreiben?
BS: Die zentrale Botschaft des Johannesevangeliums ist Jesus Christus selbst. Er macht dort prägnante „Ich bin“-Aussagen über sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit offenbart er sich selbst. In Christus teilt sich Gott dem Menschen selbst mit von Anfang an. Wer an Jesus glaubt, glaubt an Gott. Die sieben Zeichenhandlungen, (keine Gleichnisse) wie z.B., die Wandlung von Wasser zu Wein bei der Hochzeit von Kana, verdeutlichen die Identität Jesu, damit wir glauben, dass Jesus der Gesandte, der Retter ist. Dies ermöglicht dem Glaubenden im Hier und Jetzt in die bleibende Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Wer im Glauben dieses Evangelium liest, erlebt Begegnung. Dies ist eine Einladung an jede(n) von uns, sein Herz zu öffnen, Gott eintreten zulassen in seinem Leib, in der Seele und im Geist und besonders mit einem liebenden Herzen. Das 4. Evangelium bleibt Begegnung heute und morgen.
HB: Es gibt bei Johannes keine Weihnachtsgeschichte. Hat er trotzdem eine Weihnachtsbotschaft?
US: „Am Anfang war das Wort…“, so beginnt das Evangelium am 25. Dezember.. Um beides geht es. Ums Anfangen. Und darum, was aus unseren – oft so gut gemeinten – Worten wird, ob sie wirklich „Fleisch werden“. Johannes legt den Finger in die Wunde einer Welt, auch einer Kirche, der es genau daran mangelt. An beidem. Er nennt das „Finsternis“. Und es braucht Zeugen wie den Täufer, die dagegensetzen. Die das Gegenteil wollen: leben im Licht. Gott ist das Licht! Und Er macht ernst, Er selber setzt den Anfang: Seine Liebe, Sein Wort wird Fleisch, bekommt Hand und Fuß. Das Zeichen: ein Kind. Licht in der Nacht leerer Worte. Das ist Weihnachten. Aber nicht als göttliche Solo-Vorstellung vor 2000 Jahren. Im Gegenteil: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden.“ Also darf ich es riskieren, ein Anfänger zu sein.
Das eine Wort und die vielen Wörter
Die Frage, womit alles begann, ist eine der Grundfragen menschlicher Existenz. Wir wollen unser Leben einordnen, verstehen, wer und wo wir sind; und dazu brauchen wir Eckdaten über Ursprung und Ziel. Bislang konnte darauf niemand eine Antwort geben, die auch nur annähernd umfassend und abschließend wäre. So stehen sie nebeneinander, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und philosophischen Theorien und Ideen, was war, als nichts war und womit anfing, was ist.
Als Johannes sein Evangelium verfasst, weiß er: Wenn er von Jesus, dem Christus, schreibt, dann geht es um alles. Um Leben und Tod, um Anfang und Ende. Aufgeschlagen liegt das Buch der göttlichen Weisung vor Johannes, seine Bibel, wie dort beschrieben wird, auf welche Weise alles begann: Im Anfang schuf Gott … (Gen 1,1). So will er auch anfangen, genau so – und doch ganz anders. Viel grundsätzlicher, viel philosophischer, viel abstrakter: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort (Joh 1,1). Für den wortgewandten und gedanklich tiefschürfenden Evangelisten Johannes hat der Ursprung des Universums nichts mit Materie zu tun, mit Wasser und Licht, sondern er ist ein Sprechakt. Wenn Gott spricht, dann geschieht Großartiges, entsteht Leben, das einen Sinn hat.
Allerdings ist das Wort, das Gott spricht, keines, wie wir sie täglich zu hunderten von uns geben. Es reduziert sich nicht auf Buchstaben, Silben und einzelne Klänge. Das Wort, das von Gott kommt, schafft unmittelbar Wirklichkeit. Was er sagt, geschieht. Nur: Damit wir es verstehen können, muss es erst einmal in menschliche Sprache übersetzt und dann gedeutet werden. Am besten von vielen. Wieder und immer wieder. Hinein in alle Kulturen und geschichtlichen Epochen. Von Generation zu Generation. An jedem Tag ein neuer Anlauf.
Die Beiträge der Kirche im Radio, die andere und ich sprechen, versuchen genau das zu sein: eine ununterbrochene Annäherung an das Wort, das Gott spricht. In den vielen, vielen Worten, die wir dabei machen, geht es im Kern immer um das eine Wort, das von Gott kommt. Es geht darum, zu verstehen, was er uns mitteilt, was er bewegen und ändern will, und es dann so auszudrücken, dass für möglichst viele ein kleines Bisschen etwas davon verständlich wird. Um das zu garantieren, versuchen wir vor allem drei Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
Erstens. Wir gehen respektvoll vor. Wenn wir etwas über Gott sagen – wie er ist, was er will, wie er sich zu diesem oder jener Frage äußern würde – dann achten wir darauf, Gott nicht zu sehr zu vereinnahmen. Wir besitzen nämlich Gott nicht. Bei allem, was wir sagen, hüten wir uns davor, das Wort, das Gott spricht, für unsere Absichten zu missbrauchen, es gar zu einer Waffe zu machen, mit der wir andere der Lüge bezichtigen. Wir nähern uns allenfalls schüchtern der Wahrheit an und behandeln ihn wie einen Schatz in zerbrechlichen Gefäße (2. Kor 4,7). Wir wissen, dass immer ein gewaltiger Rest übrigbleibt, den wir nicht verstehen, der unser Sprechen übersteigt, weil Gott uns Geheimnis bleibt.
Zweitens. Wir sprechen so, dass wir von jedem verstanden werden. Komplizierte Formulierungen und eine wissenschaftliche Fachsprache helfen nicht, um Gott zu den Menschen zu bringen. Gerne knüpfen wir daran an, was wir selbst erlebt haben und hoffen; das hilft dem Hörer, seine eigenen Glaubenserfahrungen zu deuten. Was Gott spricht, ist nicht für einen exklusiven Kreis reserviert. Es beschränkt sich nicht auf die Grenzen der Glaubensgemeinschaft Kirche. Im Gegenteil: Wir denken zuerst an die, die aus Zufall gerade am Radio sitzen, die von der Kirche enttäuscht sind und daran zweifeln, dass es Gott überhaupt gibt. Dabei wissen wir uns bei Jesus in guter Gesellschaft, der an die Hecken und Zäune ging, um Menschen zu erreichen.
Deshalb drittens. Wenn es überhaupt ein verbindliches Kriterium dafür gibt, wie wir das deuten, was wir von Gott verstehen, dann dieses: Es darf nicht im Widerspruch dazu stehen, wie Jesus gedacht und gesprochen, gehandelt und gelebt hat. Es muss die Liebe vermitteln, die im Zentrum seiner Person stand. Weil er, Jesus der Christus, jenes entscheidende Wort ist, das Gott in der Geschichte jemals gesprochen hat.
Womit sich der Kreis schließt und wir wieder beim Prolog des Johannes sind: Im Anfang war das Wort … und das Wort ist Fleisch geworden.
Thomas Steiger, Hörfunkpfarrer der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Es ist halb acht Uhr morgens und ich laufe auf den Eingang des neuen Caritas Zentrums in der Hechingerstraße zu. Draußen ist es noch dunkel. Die Tage sind wieder kürzer geworden und ich bediene den Lichtschalter beim Betreten meines Büros. Im neuen Tübinger Beratungsbüro habe ich seit einer geraumen Zeit ein heiliges Bild mit Holzrahmen aufgehängt, eine Ikone der Gottesmutter vom Berg Athos. In ihren geborgenen und schützenden Armen hält sie den neugeborenen Heiland – Jesus Christus. Ein leuchtender und zugleich freudiger Anblick, der mir jeden Morgen entgegen kommt. Nicht selten werde ich bei der „Allgemeinen Sozialberatung“ angesprochen, woher ich diese Ikone habe. „Das ist ein Geschenk“ und gleichzeitig bekomme ich zu hören: ein schönes Bild.
Wir bewegen uns auf die Vorweihnachtszeit zu, die uns eigentlich eine Zeit der Stille und Besinnung verspricht. Die Ankunft des Herrn. Leider sieht unsere Welt, in der wir leben oft anders aus. Menschen begegnen uns, die in Not leben, und um Hilfe und Unterstützung suchen. Solche Begegnungen erlebe ich, wenn immer wieder Menschen anrufen, eine Nachricht schreiben und zu mir kommen, um das kostenlose Hilfsangebot für eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Das lässt oft den stärksten Menschen nicht einfach los. Es sind vorwiegend ältere Menschen, die am Existenzminimum leben und auf Hilfe angewiesen sind. Aber auch alleinerziehende Mütter und Väter beklagen sich über die Benachteiligung im Umgang bei Behördegängen und klagen über die hohen Preise. Menschen aus Migrantenfamilien und die wegen Verfolgung und Furcht nach Deutschland geflüchtet sind, kommen und berichten über ihre aktuelle Notlage.
Und immer wieder lächelt das Bild auf der Wand und spendet Trost und Zuversicht jedem, der es anschaut, als wäre es die eigentliche Quelle des Lichts.
Vor einiger Zeit wurde ich bei einem Beratungsgespräch angesprochen, wieso es auf der Welt solch eine Ungleichheit gibt. Da dachte ich an einen Kirchenvater, der sagte, dass die Zeit, in der man geboren wird und lebt, nicht ausgesucht werden kann. Es hängt nicht vom Menschen ab, sagte er, von welchen Eltern, noch von welcher Nation man geboren wird, sondern vom Menschen allein, wie er sich verhält.
Aber wie um Gottes Willen kann man einer überforderten Mutter mit einem kranken Ehemann und zwei kleinen Schulkindern erklären, wie der arbeitslose Familienvater wieder auf die Füße kommt, ohne die geforderten Anträge gestellt zu haben? Oft genügt hier, die fehlenden Dokumente mitzubringen und das Formular auszufüllen mit dem Hinweis auf eine Verlängerungsfrist beim Antragsnehmer. Aber auch ein tröstendes Gespräch hilft dem gegenüber sehr.
„In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen“ (Joh. 1,4-5). Der Heilige Apostel und Evangelist Johannes hat die Menschwerdung Christi so beschrieben: Gott schenkt uns seinen einziggeborenen Sohn, damit wir in ihm sind. Die Dunkelheit ist etwas Begrenztes, weil es von geschaffenen Wesen kommt; und das Licht Gottes ist grenzenlos, daher kann die Finsternis es nicht einholen. Dieses Mysterium gibt uns den Auftrag, dass wir uns für den anderen einsetzen sollen. Für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist nicht immer Geld, nicht Macht und nicht Leistung. Das ist auch nicht Besitz, Konsum oder Askese. Vielmehr ein unbezahlbares „Geschenk“, wie viel ich für den anderen da bin. Für meinen Nächsten und für mich selbst… Bratislav Bozovic, Caritas Schwarzwald-Gäu
Meine vinzentinische Spiritualität ist tief verwurzelt in der Menschwerdung Jesu, wie sie im Johannesprolog beschrieben wird und lässt diese konkret werden. Gottes Menschwerdung wird für mich als Barmherzige Schwester im Nächsten buchstäblich „handgreiflich“ erfahrbar und spürbar. Das fleischgewordene Wort Gottes lebte und LEBT mitten unter uns in der Welt. Seine Herrlichkeit leuchtet in jeder Person auf!
Schauen wir zunächst auf den heiligen Vinzenz von Paul (1581-1660), was prägte sein Leben und Tun? Für meinen Ordensgründer zeigt und offenbart sich Gottes innerstes Geheimnis gerade in der Menschwerdung Jesu Christi. Sie ist für ihn der deutlichste Beweis der Liebe Gottes und tiefer Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Gott wurde Mensch - als armes Kind im Stall. Die facettenreiche Dimension der Armut ist für Vinzenz von Paul ausschlaggebend. Gott kam in seine Welt, um unser aller Schicksal zu teilen.
Die vinzentinische Spiritualität bezieht sich vor allem auf die Armen, weil Gott für uns arm werden wollte! Es waren gerade die Armen, die Vinzenz halfen, Gott immer näher zu kommen und die christliche Botschaft tiefer zu erfassen. Sie wurden für ihn zum Zeichen, in welchem das Geheimnis der Menschwerdung Gottes in Jesus aufleuchtete: „und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“
Den ethischen Dreischritt „Sehen – Urteilen – Handeln“ kennen wir. Angesichts der menschgewordenen Gottesliebe sah sich Vinzenz gedrängt, zu den Menschen hinauszugehen. Diese war Motor seines Handelns! So versuchte er nicht nur im Nächsten Gott zu „erkennen“, sondern er sah die Not seines Nächsten und half. Vinzenz beurteilte und wägte gut ab, was für konkrete Schritte der Hilfe es braucht, und handelte anschließend. Für ihn drückt die Menschwerdung Jesu in unsere Welt hinein ein dynamisches Gottesbild aus, sie ist tiefer Kern seiner persönlichen Sendung.
Vinzenz selbst bestärkte in einer Konferenz einmal seine Schwestern: „… dreht die Münze um, und ihr werdet im Licht des Glaubens erkennen, dass der Sohn Gottes, der arm sein wollte, sich in diesen Armen zeigt.“ Er lädt uns ein, bei all unseren Begegnungen tiefer zu sehen – nicht beim Äußeren oder ersten Eindruck (etwa dem Aussehen, der Herkunft, unserer vorgefertigten Meinung von jemandem oder etwas…) stehen zu bleiben, sondern einen zweiten, tieferen Blick zu wagen, welcher uns „wahrhaft“ der und dem Nächsten begegnen lässt. Die vinzentinische Spiritualität im gelebten Alltag zu verwirklichen heißt für mich zu sehen, zu hören, zu lieben, Begegnung zu wagen und mein Handeln dementsprechend auszurichten.
Nun fragt sich die ein oder der andere vielleicht, in welchem Kontext begegnen dieser Schwester in ihrer Arbeit denn „konkret Arme im vinzentinischen Sinn“? Viele Generationen unserer Schwestern versahen ihren Dienst überwiegend in Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern, in der Kinderbetreuung und Versorgung der Menschen vor Ort. Das hat unser Selbstverständnis jahrhundertlang geprägt. Als „klassische“ Barmherzige Schwester würde ich mich deshalb nicht bezeichnen. Aber das macht es für mich gerade aus.
Als junge Theologin trat ich 2011 in meine Gemeinschaft ein und wurde 2018 als Pastoralreferentin für unsere Diözese beauftragt. 5 Jahre lang war ich in der Gemeindepastoral und im Schuldienst tätig. Seit gut einem Jahr darf ich nun u.a. junge Erwachsene begleiten, die sich im Ambrosianum auf ein eventuelles Studium vorbereiten. Wieder begegnen mir Menschen, die suchen und ringen, nachfragen und hinhören, wohin ihr Leben in dieser Welt gehen kann. In Begleitgesprächen und unseren spirituellen Angeboten erlebe ich Mensch-Sein: konkret, tiefgründig und manchmal auch schonungslos.
„Meine Armen“ begegnen mir vor allem in Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Nicht weil sie materiell oder geistig arm sind (was natürlich leider zu häufig auch der Fall ist/gewesen war), sondern weil ich mit Begeisterung und Freude versuche, die mittlerweile tiefe Kluft zwischen „ihrer“ und „meiner“ Welt zu überwinden. Sobald junge Menschen begreifen: da ist eine, die trotz Schleier, Kirche und Co. normal tickt, sich für uns wirklich interessiert und uns ernstnimmt, kann Leben und auch irgendwann Glauben geteilt werden.
Das braucht oft einen unbequemen, unkonventionellen und individuellen Weg, den ich gerne gegangen bin und weiterhin gehe. - War die Menschwerdung Jesu FÜR UNS denn nichts anderes? Vinzenz sagt: „Die Liebe ist unendlich erfinderisch“ – lassen wir sie in unserer Welt Wirklichkeit werden!
Sr. Dorothea Piorkowski, Vinzentinerin, Pastoralreferentin